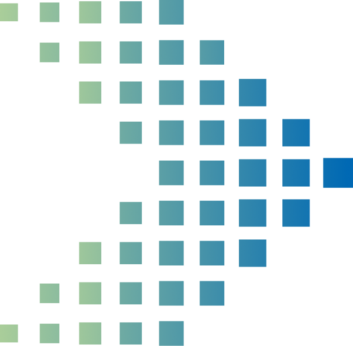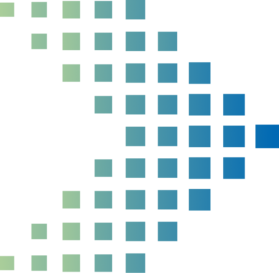Zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Die energieintensive Industrie im Spannungsfeld.
Unsere Bundesregierung hat sich ein klares Ziel gesetzt: Österreich soll bis 2040 klimaneutral sein. Für die energieintensive Industrie ist das ein enormer Anspruch. Wir arbeiten seit Jahren an Dekarbonisierungspfaden, investieren in alternative Technologien und wollen unseren Beitrag leisten. Doch zwischen politischer Vorgabe und technologischer Realität klafft eine Lücke.
Aus heutiger Sicht ist es nicht möglich, bis 2040 in allen Prozessen „Zero“ zu erreichen. Wasserstoff ist astronomisch teuer und es mangelt an Verfügbarkeit. Elektrifizierung ist ein wichtiger Pfad, aber nicht in jedem Prozess technisch oder wirtschaftlich darstellbar. Gas bleibt in vielen Bereichen unverzichtbar – sei es aus kosten- oder verfahrenstechnischen Gründen. Eine vollständige CO2-Freiheit wäre nur denkbar, wenn ergänzende Lösungen wie Carbon Capture and Storage bis dahin großflächig verfügbar und auch leistbar sind. Davon sind wir weit entfernt.
Zusätzlich stark wiegt auch die internationale Konkurrenz: Während Betriebe in den USA oder China mit deutlich günstigeren Energiepreisen kalkulieren und keine Fristen gesetzt bekommen, zahlt die Industrie hierzulande beim Strom zwei- bis dreimal und beim Gas drei- bis viermal so viel. Zusammen mit den hohen Personalkosten macht Energie in manchen Betrieben bereits über die Hälfte der Gesamtkosten aus. Das lässt sich kaum abfedern und schränkt die Wettbewerbsfähigkeit Europas massiv ein.
Hinzu kommt das Korsett der Investitionszyklen. Großanlagen in Glas, Stahl oder Chemie sind auf 15 Jahre und mehr ausgelegt. Wer heute investiert, braucht Sicherheit, dass sich diese Anlagen auch in den 2040er-Jahren noch wirtschaftlich betreiben lassen. Planungssicherheit ist daher eine Grundvoraussetzung: verlässliche Energiepreise und Versorgungssicherheit durch hohe Eigenversorgungsquoten und Diversifizierung der Energiebeschaffung, günstige Netzgebühren und eine Fortführung und Ausweitung der Strompreiskompensation mindestens bis 2030 sowie klare regulatorische Leitplanken, die nicht alle zwei Jahre neu justiert werden. Nur so lassen sich die Millioneninvestitionen tätigen, die für die Transformation notwendig sind.
Ein einmaliges Konjunkturpaket von einer Milliarde Euro ist in diesem Umfeld kaum mehr als der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Spielentscheidend sind strukturelle Maßnahmen, die den Faktor Arbeit signifikant entlasten und die Verfügbarkeit von Fachkräften langfristig absichern – und dann eine Industriepolitik, die internationale Chancengleichheit herstellt und damit die Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellt. Denn wer weiß, dass es im internationalen Wettbewerb auf jedes Prozent ankommt, versteht auch die Größe der Herausforderung.